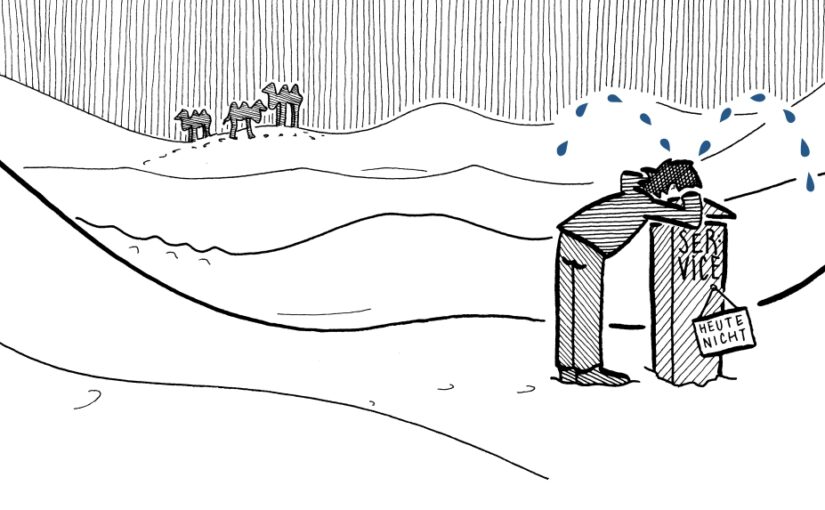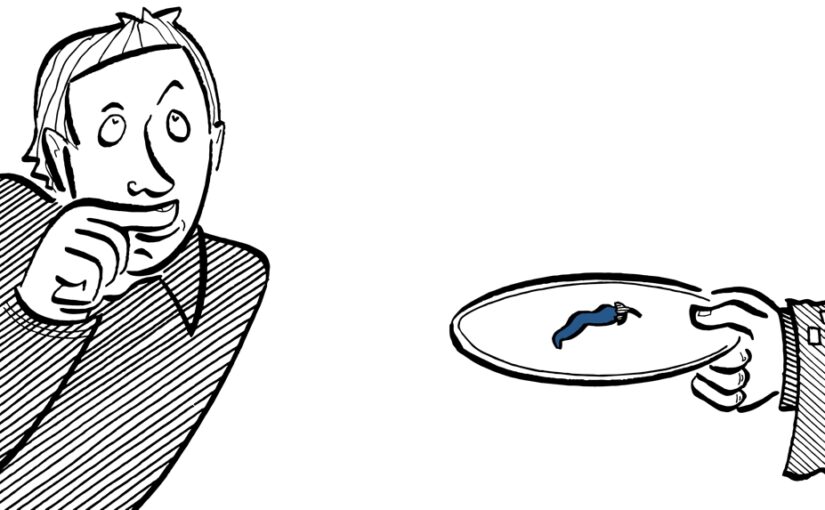Die Planung komplexer Webprojekte kann viel Raffinesse voraussetzen. Denn wo immer die Agentur Menschen, Interessensgruppen, Technologien, Geld und Zeit jonglieren muss, genügen Projektmanagementtools und Schulwissen nicht.
Das Zauberwort heisst «Risikomanagement». Es definiert alle Massnahmen und Beurteilungen, die die Risiken in einem Projekt identifizieren und bewerten. Der Detektiv forscht, wie und wann es zu einer Sachlage hat kommen können, wohingegen der Projektmanager problematische Konstellationen verhindern will und diese bewusst einplant, um sie vor oder bei Eintreffen zu umschiffen.
Dass der Projektverantwortliche in Agenturen oftmals als Miesepeter – wenn auch mit sarkastischem oder fatalistischem Humor – wahrgenommen wird, hat in der Jobdefinition seinen Grund: Probleme voraussehen und benennen ist Agenturalltag.
Wenn er die Winkelzüge der Interessensgruppen versteht, das – wenn auch oftmals sympathische – Durcheinander bei Kunden durchschaut, die Alltagssorgen seines Technik-, Kreations- und Beratungsteams im Griff und – natürlich – das Projekt mit all seinen Facetten verinnerlicht hat, wird er zum unverzichtbaren Verantwortlichen.
Ein normaler Mensch sieht bei «1 + 1» eine einfache Addition; der Projektmanager hingegen fragt sich, ob die Addition im Dezimal- oder einem anderen Zahlensystem ausgeführt werden soll, hakt nach und informiert alle, die es wissen müssen.
Darin unterscheidet sich der Profi vom Windmacher: Projektdetails ohne Vorlage kennen, Eckdaten aus dem Effeff beherrschen, Teamagendas verinnerlichen, Feintöne heraushören, Probleme voraussehen, Stolpersteine erkennen und Sprachbarrieren beseitigen – das alles gehört mehr zum Job, als es dessen Beschrieb erahnen lässt.
Und dann noch Weihnachten: Niemand will, aber alle müssen – oder … alle wollen, und niemand verzichtet. Oder soll man? Oder möchte man? Oder dürfte man …?
Seien und bleiben Sie gut organisiert, geniessen Sie die Zeit und achten Sie unbedingt auf Ihre Gesundheit – im Körper wie im Geist.